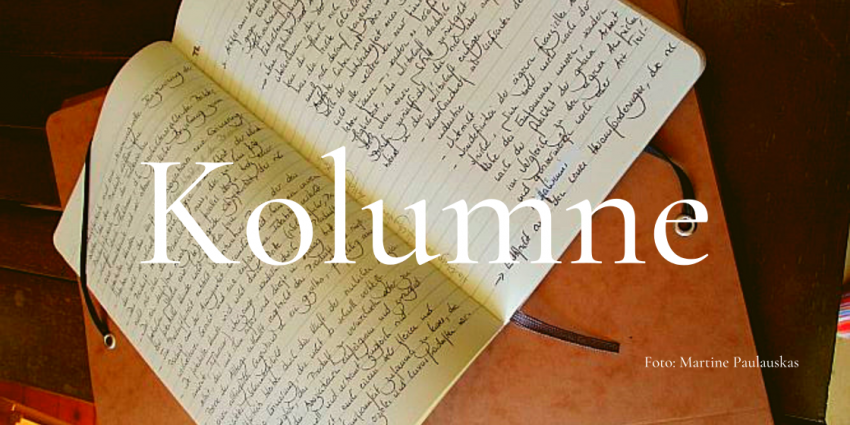Eine Online-Bekanntschaft sagte mir eines Tages: „Du bist aber genügsam!“. Sie sprach damit auf die Tatsache an, dass ich, ob es sich dabei um Haushaltsgegenstände oder Kleidung handelt, nur dann etwas kaufe, wenn ich es brauche. Ich ersetze Elektrogeräte nur dann, wenn sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen, weil sie etwa endgültig defekt und nicht mehr zu reparieren sind, Kleidung nur, wenn sie nicht mehr oder nur noch für Garten- und Hausarbeit fern fremder Augen getragen werden kann. Ebenso bin ich der Meinung, dass unabhängig der Einkommenshöhe besondere Dinge nur dann besondere Dinge sind, wenn sie ausgesuchten Gelegenheiten vorbehalten bleiben und jede Besonderheit verloren geht, wenn man sie sich jeden Tag gönnen würde. Dass sich diese Einstellung auch nicht ändern würde, wenn ich Milliardär wäre, machte mich in den Augen dieser Bekannten jedenfalls zu einem Kuriosum, auch wenn ich nicht begriff, wieso. In ihrer Stimme mischten sich Erstaunen, Verblüffung, Amüsiertheit, auch aber auch etwas Enttäuschung und Verständnislosigkeit und es bestand kein Zweifel darin, dass der Satz missbilligend, ja gar spöttisch gemeint war. Aus ihrer Sicht war Genügsamkeit vermutlich so etwas wie Geiz und auf jeden Fall etwas Putziges, Goldiges, Fremdes, Naives, das nicht ernst zu nehmen war.
Ich wiederum hatte nie über diesen Begriff nachgedacht, das Wort selbst wohl noch nie benutzt – es hätte vermutlich nicht einmal zu meinem aktiven Vokabular gehört. Das, was sie damit beschrieb, empfand ich lediglich als „normal“.
Mir war bewusst, dass es Menschen gab, die andere Ansprüche haben, anders leben und denken als ich, und ich kannte sogar einige, aber war mir ihr Verhalten absolut egal, so hätte ich es dennoch nicht für die Regel, das Normale, den Durchschnitt gehalten. Wenn ich nicht so entsetzlich gleichgültig gewesen wäre – manche sagen dazu „tolerant“, aber tatsächlich interessiert es mich schlichtweg in keiner Weise, wie andere solche Angelegenheiten handhaben – und wenn ich mir die Zeit genommen hätte – hier würde ich eher sagen: meine Zeit damit verschwendet hätte –, über sie nachzudenken, dann wären sie mir wahrscheinlich kaum sympathisch gewesen. Ihre Werte und Prioritäten, man könnte sagen: ihre Wirklichkeit und ihre Wahrheit, ihre Einstellung zu Leben und Dingen wären nicht meine. Bestenfalls wären sie mir fremd gewesen, schlimmstenfalls hätte ich mir selbst eingestehen müssen, dass ich sie als dumm und unreflektiert empfinde. Glücklicherweise ist für mich „leben und leben lassen“ nicht nur ein dahingeworfener Spruch, er entspricht wirklich meiner Art, anderen zu begegnen.
Gleichwohl war mir die Gier nach „immer mehr“ schon als Kind im Grundschulalter unverständlich. Warum Wirtschaftswachstum etwa so wichtig sei und weniger Gewinn, was immer noch Gewinn überhaupt bedeutete, als Katastrophe stilisiert wurde, erschloss sich mir nicht, und die Antworten der Erwachsenen wollten mich dahingehend nicht befriedigen. Vermutlich fehlt mir die Fähigkeit, zu reifen, denn darin hat sich bis heute nichts geändert. Ich begreife nach wie vor nicht, was der Reiz daran sein kann, die Karriereleiter hochzuklettern, wenn man genug verdient, um sich sicher und bequem zu versorgen, und das heutige Firmenhopping auf der Suche nach einer immer besseren Anstellung finde ich schlicht lächerlich. Ehrgeiz sollte sich in meiner Vorstellung in dem Willen äußern, sinnerfüllt zu arbeiten und es in dem, was man tut, zu Perfektion und Virtuosität zu bringen. Das „Immer mehr“ in Kategorien von „Geld-oder-Wohlstand-wollen“ empfand ich schon als kleiner Knirps als hohl.
Was ich damals nicht wusste, war, dass diese offenbar spotterregende Eigenschaft nur wenige Jahrzehnte später unter der Bezeichnung „nachhaltig leben“ Mode und Konzept werden sollte. Der Kontakt zu dieser Bekanntschaft, die eher oberflächlicher Natur war, besteht schon lange nicht mehr, aber ich muss oft schmunzelnd an sie denken und frage mich, was sie von dem heutigen Trend hält.